Die Cime de la Bonette ist ein Berg in den südfranzösischen Alpen, der aussieht wie die Landschaft einer Modelleisenbahn-Welt. Die steinernen Hänge sind nur spärlich und matt mit Gras bewachsen. Etwas mehr als 2.800 Meter Höhe misst der Pass. 2024 stellte er das Dach der Tour de France dar, war der höchste Punkt des Radrennens. Für die Profis eine Tortur. Die Luft ist dünn, deutlich weniger Sauerstoff gelangt ins Blut. Was ohnehin anstrengend ist, das Berghochfahren, artet zur Qual aus.
Rad-Abenteurerin Juliane Bötel kann darüber trotzdem nur schmunzeln. Sie war drei Wochen lang auf 4.000 Metern unterwegs. Auf dem tibetischen Hochplateau, im tiefsten China, im Vorgarten des Himalaja-Gebirges.
Das Rad schwer beladen, die Straßen teils wüst und buckelig. Und dann erwischte sie noch der Worst Case in einer Unwetternacht. Ob sie ihren Traum von Tibet erfüllen konnte? Wie man sich in den Alpen an diese Strapazen gewöhnt? Und was jeder Mensch an Höllentagen für das Leben lernen kann? Das und mehr erfährst du im Interview.

Über Juliane Bötel
Juliane Bötel, geboren 1984, lebt in Garmisch-Patenkirchen. Dort leitet sie die Kommunikationsabteilung eines Fahrradherstellers. Sie ist auf Langstreckenfahrten aktiv, fuhr unter anderem großen Strecken über die Alpen und im auf dem Balkan.
Beat Yesterday: Juliane, erzähl: Du hast etwas Verrücktes auf dem Rad erlebt. Um nicht zu sagen: etwas Absurdes. Was hast du angestellt?
Juliane Bötel: Ich war mit dem Fahrrad in einer der abgelegensten Regionen des Planeten unterwegs, geografisch und politisch betrachtet. Ich war 650 Kilometer mit 11.000 Höhenmetern auf dem tibetischen Hochplateau Bikepacken. Zu jeder Zeit 3.500 bis 5.000 Meter über dem Meeresspiegel.
Beat Yesterday: Wie kommt man auf so eine verwegene Idee?
Juliane Bötel: Ich habe von 2010 bis 2013 in China gelebt und bei einem deutschen Autokonzern gearbeitet. Nicht nur, weil ich gemerkt habe, dass das nicht meine Industrie ist, hat mich diese Zeit sehr geprägt. Ich habe dort zum Beispiel so richtig mit dem Fahrradfahren angefangen und empfinde die Zeit heute noch als sehr prägend. Ich weiß auch nicht – irgendwie klebe ich emotional an diesem Land.
Beat Yesterday: Wie genau hat China das geschafft?
Juliane Bötel: Es ist ein sehr widersprüchliches Land, das mich trotz der vielen politischen und gesellschaftlichen Misslagen nie losgelassen hat. Die Menschen sind unfassbar großzügig und offen. Die Kultur – oder besser: die Kulturen – sind unsagbar spannend und lehrreich. Vor allem Tibet hat mich fasziniert, die Wiege des Buddhismus. Nicht vordergründig als spiritueller Ort, sondern als magische Region mit atemberaubenden Berglandschaften. Und natürlich mit der tragischen Geschichte und Gegenwart. Tibet ist ein von China unterdrücktes Land. Der Gedanke an Tibet hat mich gefesselt. Auch als ich tausende Kilometer weit weg war.

Beat Yesterday: Deine Reise, die du „Forbidden Frontiers“ nanntest, verbotene Grenzen, hat dich nicht direkt aber nicht durch Tibet geführt. Warum?
Juliane Bötel: Weil es in Tibet sehr strikte Einreisebeschränkungen gibt. Klar, man kann mit einer Reisegruppe samt gestellter chinesischer Reiseleitung einreisen. Also dann, wenn man durch diverse Checks kommt. Aber das passt nicht zu meinem Freiheitsdrang und meinem Wunsch zu reisen. Ich mache die Dinge gern auf meine Weise. Was ich aber wusste, und was zu der Suche nach meinem Sehnsuchtsort passte: Man kann den Geist von Tibet auch spüren, wenn man durch die angrenzenden chinesischen Provinzen reist.
Beat Yesterday: Warum?
Juliane Bötel: Die drei chinesischen Grenzregionen liegen geografisch auf dem tibetischen Hochplateau und gehörten mal politisch zu Tibet. Das heißt: Kultur und Geschichte sind dort noch intensiv fühlbar.






Beat Yesterday: Wir haben es im Intro bereits angerissen. Die Reise ist natürlich aufgrund der politischen Situation mehr als ein Abenteuer. Sie ist ein Wagnis – aber fast noch mehr wegen der Topografie. Drei Wochen im Schnitt bei mehr als 4.000 Höhenmetern. Diese Höhe bieten nur sehr wenige Alpengipfel. Wie entwickelt man eine Lust auf das Terrain?
Juliane Bötel: Ich bin 2018 nach Bayern gezogen. Da entdeckte ich dann meine große Liebe für die Berge. Seitdem sitze ich nicht mehr ausschließlich auf dem Rad, sondern erschließe sie auf alle möglichen Weisen und zu allen Jahreszeiten. Beim Bergsteigen und Klettern, Trailrunning und beim Skifahren. Die Tibet-Idee bot irgendwie das Beste aus beiden Welten: Bikepacking und hohe Berge. Davon sollte ich auf dem Hochplateau mehr als genug bekommen.
Beat Yesterday: Wie fühlt sich Fahrradfahren auf 4.000 Metern an?
Juliane Bötel: Langsam. Erstmal war ich schwer beladen. Alles, was ich brauchte, um autark unterwegs zu sein, hatte ich am Rad. Das sind neben Koch- und Schlafsystem auch warme Klamotten. Dazu kam die Höhe. Die Luft ist arg dünn, man spürt richtig, wie der Körper erschöpft ist – alleine durch seine Anwesenheit in dieser Region. Und das trotz vorheriger Akklimatisierung. Ich bin selten im Schnitt mehr als 15 Kilometer pro Stunde gefahren. Sind sonst 150 bis 200 Kilometer am Tag kein Problem für mich, sind 100 Kilometer mit 1.000 Höhenmetern sehr viel.

Beat Yesterday: Du sprichst beim Thema Höhe etwas Wesentliches an. Die Akklimatisierung. Die war bei dir besonders spannend. Warum?
Juliane Bötel: Ich bin voll berufstätig, kein Vollprofi oder eine Influencerin, die von solchen Reisen lebt. Ich hatte drei Wochen Urlaub für die Reise. Nicht mehr, nicht weniger. Es war also keine Option, erst in China mit der Höhenakklimatisierung anzufangen. Das wäre sehr zeitintensiv geworden. Also habe ich mir für zu Hause ein Höhenzelt geliehen. Darin habe ich dann vier Wochen lang Höhe simuliert und am Ende quasi auf 4.000 Metern geschlafen. Damit der Körper sich an die Gegebenheiten gewöhnen kann. Damit er nachts lernt, mit der dünnen Luft klarzukommen.

Beat Yesterday: Wie funktioniert das?
Juliane Bötel: Man schläft in einem Zelt, das mit einem lauten Generator verbunden ist. Dieser entzieht – vereinfacht dargestellt – der Atemluft eine gewisse Menge an Sauerstoff. Über einen Schlauch kommt diese Luft dann ins Zelt. Mit „steigender Höhe“ fällt der Luftdruck und damit der Sauerstoffgehalt in der Luft – genau das wird auf die beschriebene Weise simuliert.
Ich habe mit dem Zelt auf 2.500 Metern angefangen und mich dann sukzessive in 300-Meter-Schritten „hochgeschlafen“. In den letzten zwei von insgesamt vier Wochen habe ich dann die Nächte auf „Wettkampfhöhe” simuliert, sozusagen. 4.000 Meter. Die ersten drei Wochen der Akklimatisierung waren krass. Am Ende ging es gut, weil der Körper sich angepasst hat.
Beat Yesterday: Ich kann mir vorstellen, dass es sich trotzdem nicht unbedingt gut anfühlt.
Juliane Bötel: Ja, das ist richtig Hölle. In der Zeit habe ich sogar eine Excel-Tabelle mit meinen Garmin-Daten gefüttert. Es war total spannend, denn sie bestätigten die Theorie der Akklimatisierung in der Praxis: Mit jedem 300-Meter-Schritt sank der Sauerstoffgehalt im Blut, wie auch die Herzfrequenzvariabilität. Der Puls stieg hingegen an.
Die Daten bestätigten auch, was ich nachts fühlte: Ich war total erledigt und knautschig. In der Nacht selbst, vor allem aber am nächsten Morgen. So ein Höhenzelt bekommt dem Sleep Score von Garmin nicht gut. Aber auch dieser stieg ab Mitte der zweiten Woche wieder an, als der Körper sich mehr und mehr anpasste.
Beat Yesterday: Vier Wochen Strapazen, ein Sleep Score, der wie ein Jojo hüpft. Was hat es dir gebracht?
Juliane Bötel: Der Körper hat sich an die Höhe gewöhnt. Es ist faszinierend, wie das funktioniert. Der Organismus produziert mehr rote Blutkörperchen, die für den Sauerstofftransport zuständig sind. Dadurch kann er mit dem geringeren verfügbaren Sauerstoff besser umgehen und den Körper versorgen. Der Sauerstoff wird viel effizienter genutzt. Mein Körper war am Ende so gut auf die Höhe vorbereitet, dass zumindest sie kein Problem auf der Reise war.
Höhenakklimatisierung bei Garmin
Garmin analysiert anhand deiner Trainingsdaten, wie gut dein Körper mit Höhen über 800 Metern zurechtkommt. Die Funktion unterstützt Sportlerinnen und Sportler bei der Planung und Steuerung von Belastung in großen Höhen.
- Verwendet werden GPS-, SpO₂- und Herzfrequenzdaten zur Einschätzung der Anpassung.
- Die Funktion ist aktiv bei regelmäßiger Bewegung über 800 m Höhe.
- Sie liefert ein numerisches Akklimatisierungs-Level (0–100) mit Tendenz (steigend/fallend).
Beat Yesterday: Wenn schon nicht die Höhe – was war die größte Herausforderung auf deiner Reise?
Juliane Bötel: Ausgerechnet kurz vor der Königinnenetappe, die auf einen 5.050 Meter hohen Gravel-Pass führen sollte, bin ich krank geworden. Ich bekam Magen-Darm-Probleme. Alles, was an Energie reinkam, kam wieder raus. Drei Tage lang. Ich war komplett leer. Es war eine Grenzerfahrung.
Am schlimmsten war die zweite Nacht. Ich versuchte zu essen, weil ich vor einem langen und vor allem hohen Anstieg am nächsten Tag wirklich frische Kräfte brauchte. Aber nichts blieb drin! Alle zehn Minuten musste ich aus dem Zelt raus und konnte mich nicht ausruhen. Über mir tobte zudem ein heftiges Gewitter. Und das ist in den Bergen kein Spaß. Können sich alle ausmalen, wie das ist, wenn nur ein Zelt einen auf einem Berg vor Blitzen, Sturm und Starkregen schützt. Wenn man denn das Glück hat, sich im Zelt aufzuhalten. Ich dagegen hockte permanent draußen im Regen und konnte nicht mehr. Und das auf 4.300 Metern Höhe.



Beat Yesterday: Wolltest du auch nicht mehr? Also: Dachtest du an das Aufgeben?
Juliane Bötel: Nein. Vor allem: Wie denn aufgeben? Ich war nicht in den Alpen. Nicht nur eine kurze Autofahrt von zu Hause entfernt. Ich hätte ja mit meinem ganzen Zeug erstmal wieder zurück in die Zivilisation radeln müssen. Zum Flughafen kommen. Abbruch war keine Option. Und den Pass auszulassen – auch nicht. Selbst daran habe ich nicht eine Sekunde gedacht. Ich hatte meinen Sehnsuchtsort vor Augen. Den Ort, von dem ich fünf Jahre lang geträumt hatte. Der motiviert mehr als alles andere.
Beat Yesterday: Gab es keine Chance, die Schwierigkeit zu senken?
Juliane Bötel: Die gab es. Ich hätte auch den Berg wieder runterfahren, mich im Tal erholen und dann zwei Tage später nochmal starten können. Oder ich wäre einfach durch den Tunnel gerollt und alles wäre leichter gewesen. Aber wie gesagt: Es war nie eine Option. Ich wollte mit dem Rad hoch hinaus, zu diesem magischen Ort, der höher liegt als der Mont Blanc. Und trotz der miserablen gesundheitlichen Situation, in der ich mich befand, wusste ich, dass ich es schaffen kann.
Beat Yesterday: Wie hält man solche Höllentage mental durch?
Juliane Bötel: Witzig ist: Ich habe mir vor der Reise Glaubenssätze notiert, die ich für solche Situationen rausholen wollte. Sogenannte Affirmationen. Ich habe sie mir vor Ort nicht angeschaut, aber ich habe sie offensichtlich mehr als verinnerlicht. Denn passender hätte ich sie nicht formulieren können. Am Ende habe ich vor Ort eine innere Stärke gefühlt. Es war keine Reise, die für spirituelle Momente konzipiert war. Dennoch fühlte ich so etwas mit der Zeit. Es entwickelte sich ein Vertrauen in die eigene Stärke, das mir zwar bekannt vorkam, das ich aber noch nicht in dieser Dimension wahrgenommen hatte. Davon zehre ich heute noch, Monate nach meiner Reise.


Beat Yesterday: Worüber wir noch gar nicht gesprochen haben: die infrastrukturellen Bedingungen. Ich denke bei China an schlechte Straßen, um nicht zu sagen: Provinz.
Juliane Bötel: So irren sich viele. Teilweise gab es auf dem Plateau richtig gute Straßen. Die Reifen rollten perfekt. Knapp ein Drittel der Strecke war tipptopp. Dazu kam aber auch das Gegenteil, das Klischee: richtig üble, kaum befahrbare Wege – vor allem mit dem schwer beladenen Rad. Ich musste zeitweise schieben, auch lange, zu steile bergauf Passagen.
Was mich besonders freute: Auch Schotterpisten kamen vor. So ein richtiges Gravel-Paradies. Diese Abwechslung zwischen den Strecken tat mir gut. Der Großteil der Strecke war landschaftlich und technisch wirklich ein Traum, und sehr „remote“, also abgelegen. Ich habe manchmal über mehrere Tage keine Menschenseele gesehen.








Beat Yesterday: Wie hat dein Fahrrad das überstanden?
Juliane Bötel: Ich hatte keine einzige richtige Panne. Das war wichtig. Das hätte ich gerade während der Krankheit nicht gebrauchen können.
Beat Yesterday: Was heißt „richtige Panne“?
Juliane Bötel: Als ich das Fahrrad in China aus dem Karton geholt habe, gab es ein Problem. Ich habe den Steuersatz nicht richtig festgezogen bekommen. Da war immer noch Spiel, zu viel, und ich konnte ihn nicht richtig einstellen. Und ich kenne mich ja mit Rädern ganz gut aus. Ich arbeite in der Fahrradindustrie, bastle seit Jahren viel an Rädern herum. Und jetzt hatte der Steuersatz „Spiel“.


Beat Yesterday: Laien könnten sagen: Nicht so schlimm, so ein bisschen „Spiel“.
Juliane Bötel: Wäre es eine reine Rennradtour gewesen, hätte ich gesagt: passt schon irgendwie. Ziehe ich halt immer wieder fest. Aber Offroad muss ein Rad mehr aushalten, vor allem mit dem schweren Gepäck. Die Abfahrten waren teilweise die Hölle. Ich hatte Angst, dass der Rahmen brechen könnte oder mir der Lenker wegschmiert. Da half nur Vertrauen und vielleicht göttlicher Beistand. Und es ist zum Glück alles gut gegangen.
Beat Yesterday: Am Ende hast du deine Ziele erreicht. Was war der schönste Moment?
Juliane Bötel: Da gab es zwei. Einer ganz konkret, die anderen diffus verteilt. Zum einen als ich den höchsten Pass erreicht hatte, 5.000 Meter, den Ziel- und Wendepunkt meiner Reise, nachdem ich drei Tage lang wegen Magen-Darm nichts essen konnte. Da habe ich alles an Positivität, Ruhe und Selbstvertrauen gespürt, was ich wohl spüren kann. Einer der besten Momente meines Lebens. Ich hatte es geschafft. Ich hatte daran und vor allem an mich geglaubt und es durchgezogen. Das gibt einem viel Selbstwert.
Zum anderen die ganzen menschlichen Begegnungen. Ich traf in den drei Wochen nur eine Person, die Englisch sprach. Ich spreche zwar etwas chinesisch, aber das hat mir dort nur in der Kommunikation mit der Polizei geholfen. Die Locals sprechen fast ausschließlich Tibetisch, auch wenn ich mich in China befand. Die Verständigung lief also mit ein paar Vokabeln und Händen und Füßen ab. Und trotzdem wurde sich verstanden. Und geholfen. Und mit offenen Armen willkommen geheißen.
Mehr noch: Es war ein echtes Aufnehmen. Ich war als Europäerin mit meinem voll gepackten Rad keine Fremde. Auch wenn dort niemand radfährt und ich mehr als befremdlich ausgesehen haben muss. Ich wurde zum Essen eingeladen und wie ein Familienmitglied behandelt. Die, die wenig haben, geben am meisten. Die Menschen dort haben Herzen aus Gold. Da kommen mir auch Monate später wieder die Tränen.
Das ist das, was uns gesellschaftlich so fehlt. Was wir vielleicht verlieren. Dass wir uns unterstützen, dass wir uns einander annehmen, dass wir gut zueinander sind. Auf dem tibetischen Hochplateau habe ich sehr viel Liebe erfahren. Das hat mir Mut gemacht.


Beat Yesterday: Eine sehr intensive Antwort. Was nimmst du noch mit – außer diese prägenden Erfahrungen?
Juliane Bötel: Ein neues Selbstbild von mir. Es war keine spirituelle Reise, und doch brachte sie ein spirituelles Ergebnis. Ich habe immer an mir gezweifelt und war oft sehr blockiert. Bin ich gut genug? Bin ich stark genug? Habe ich genug geleistet, um Liebe zu verdienen? Ich habe mich immer so klein gemacht.
Aber dort oben, da wurden mein Körper und mein Geist zu einer Einheit, wie Yin und Yang. So eine Reise, die den Körper maximal fordert, die den Willen strapaziert und biegt, zu bestehen, hat mich unglaublich robust gemacht. Und gelassener. Ich zweifle seitdem nicht mehr so. Ich bin mehr da, mit voller Power.
Beat Yesterday: Zum Abschluss: Was rätst du Menschen, die dieses Interview lesen – und vielleicht genau jetzt nach Mut suchen?
Juliane Bötel: Tut es. Traut euch. Ihr werdet überrascht sein, zu was ihr fähig seid. In diesen Momenten, in denen man ganz bei sich ist, in denen man nur sich hat und sich auf etwas komplett Neues einlässt, lernt man viel über sich selbst, den eigenen Wert und den eigenen Weg.
Mach dein Fahrrad zum Multitalent
Egal ob Rennrad, Gravel oder Mountainbike. Den nächsten Triathlon, ein Abenteuer oder die Fahrt zur Arbeit. Wir haben Technologien auf die du dich verlassen kannst. Fahrradspezifische Routenführung, Abbiegehinweise, Sicherheitsfunktionen oder eine detailierte Trainingsanalyse – die Möglichkeiten sind unbegrenzt. Welches ist dein nächstes Garmin-Gerät?






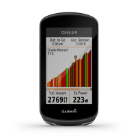







Diskutiere über diesen Artikel und schreibe den ersten Kommentar:
Jetzt mitdiskutierenDiskutiere über diesen Artikel